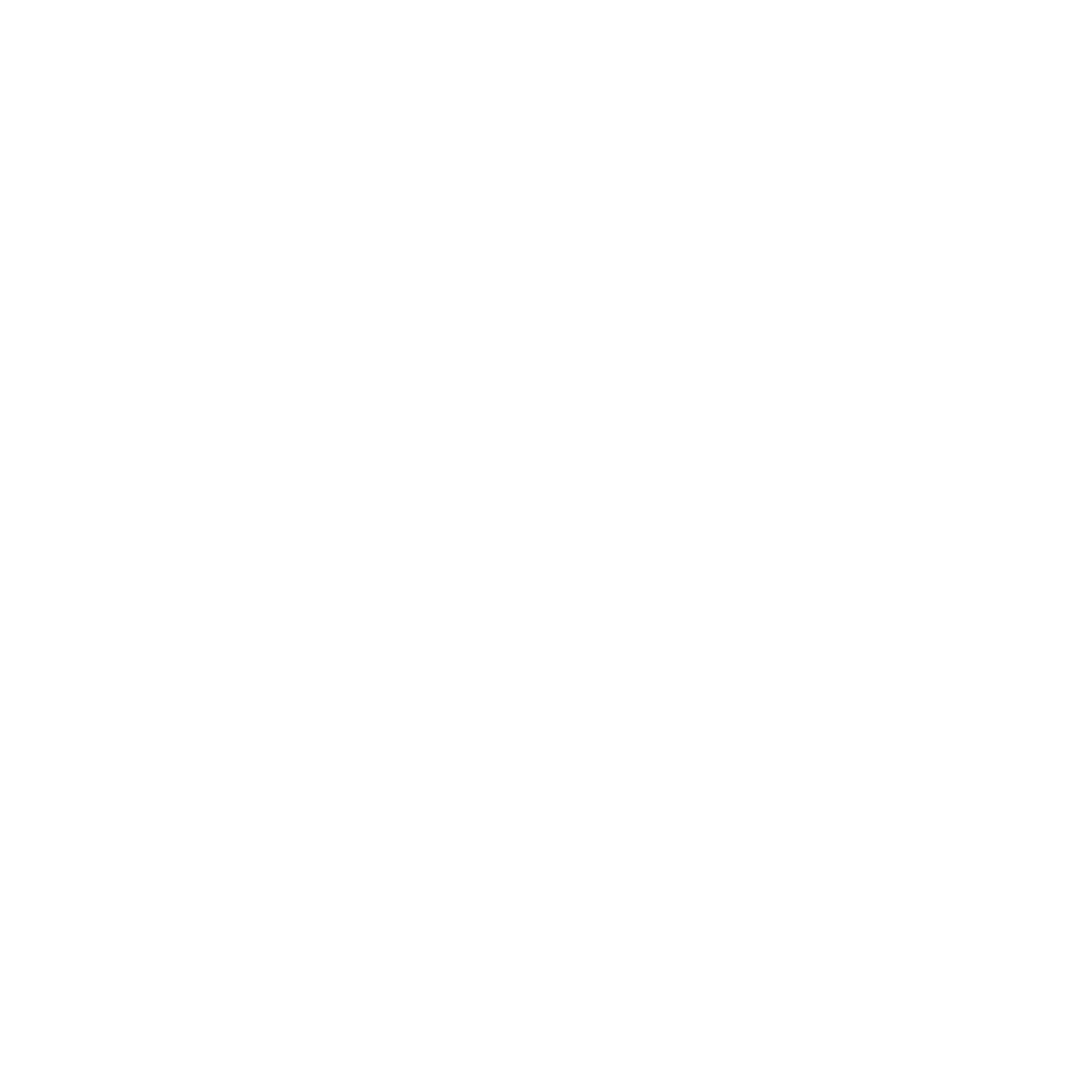Repowering bezeichnet den Austausch alter Windenergieanlagen durch moderne, leistungsstärkere Modelle. Dabei wird die Effizienz gesteigert und der Flächenverbrauch reduziert. Durch Repowering wird die Lebensdauer eines Windparks verlängert und höhere Erträge erzielt.
Video laden
Ihre Fragen – unsere Antworten
Antworten zur WindkraftDie Finanzierung des Rückbaus der Windenergieanlagen ist eine Vorgabe, um in Deutschland überhaupt eine Baugenehmigung zu erhalten. Es handelt sich hierbei um eine Rückbaubürgschaft, die zweckgebunden beim Landkreis hinterlegt wird.
Wird die Anlage nicht mehr zur Erzeugung von Strom genutzt, wird sie zu 100% abgebaut und entsorgt – auch das Fundament wird komplett entnommen.
Anlagenhersteller halten für den Rückbau wichtige technische Daten bereit, können anlagenspezifische Rückbaukonzepte empfehlen und unterstützen das Repowering.
99% der Bauteile einer Windenergieanlage sind, bezogen auf ihre Gesamtmasse, wiederverwertbar. Einzig die elektronischen Komponenten sich nicht recyclebar.
Sie bestehen zu mehr als 80 Prozent aus Stahl und Beton. Die Betonteile des Fundaments finden nach einer Aufbereitung als Recyclingbeton beispielsweise im Straßenbau Verwendung. Die Stahlsegmente gehen überwiegend als Sekundärmaterial zurück ins Stahlwerk.
Aufgrund der Zusammensetzung aus Glasfaser-, Kohlefaser- und anderen Kunststoffen ist das Recycling der Rotorblätter der wohl aufwendigste Teil. Sofern sie nicht über den Zweitmarkt – meist in Drittländern – einem weiteren Lebenszyklus zugeführt werden können, werden sie in spezialisierten Betrieben thermisch verwertet und für den Einsatz als Sekundärmaterial aufbereitet. Dazu werden die Rotorblätter zerkleinert, Metallteile wie Blitzableiter aussortiert und anschließend verbrannt. Die dabei entstehende Asche, die volumenmäßig noch etwa 30 Prozent des Ausgangsmaterials ausmacht, kann dann als Ersatz für andere Rohstoffe in der Zementindustrie eingesetzt werden.
Beim Einsatz von 1.000 Tonnen glasfaserverstärktem Kunststoff – wie er auch im Automobil-, Schiffs- und Flugzeugbau verwendet wird – können so rund 450 Tonnen Kohle, 200 Tonnen Kreide und 200 Tonnen Sand eingespart werden.
Auch die Hersteller von Windenergieanlagen setzen sich inzwischen sogenannte Null-Emissionsziele und streben eine europaweite Kreislaufwirtschaft an. Dazu investieren sie kontinuierlich in Forschungsprojekte und die Optimierung von Produktions- und Recyclingprozessen, die in öffentlichen Nachhaltigkeitsberichten dokumentiert werden.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Windenergiebranche bestrebt ist, die Recyclingfähigkeit von Windenergieanlagen kontinuierlich zu verbessern. Durch verstärkte Forschung und Entwicklung sowie den Ausbau von Recyclingkapazitäten kann die Nachhaltigkeit der Windenergie weiter gesteigert und ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden.
Das Recycling der einzelnen Komponenten von Windenergieanlagen wird durch die Norm DIN SPEC 4866 geregelt. Es werden rund 95 % aller Komponenten wiederverwendet. Die einzige Schwierigkeit stellen die Verbundstoffe in den Rotorflügeln dar. Diese sind ähnlich schwer zu trennen, wie die Verbundstoffe in unserem Hausmüll.
Unter anderem haben das Frauenhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung oder die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW bereits in Zusammenarbeit mit dem Start-up iwas-concepts AG Trennverfahren entwickelt, die mittlerweile bei der Herstellung berücksichtigt werden, um die Flügel komplett recyclebar zu machen.
Alle Metalle, wie der Stahl aus dem Turm, sowie Kupfer und Aluminium aus der Gondel, sind begehrte und wertvolle Rohstoffe, die weiterverarbeitet werden können. Der Beton kommt im Straßenbau zum Einsatz und die Schaltanlagen werden modernisiert und neu verbaut.
Viele der Alt-Anlagen finden vor ihrem Recycling noch einen zweiten Lebenszyklus und werden in europäischen Nachbarstaaten weiterbetrieben.
Die Laufzeit der Windenergieanlagen ist auf derzeit 25 Jahre ausgelegt.
Dies ergibt sich unter anderem aus den Herstellervorgaben und den technischen Gutachten zur Standsicherheit.
Als Infraschall werden Schallwellen mit einer Frequenz unter 20 Hz bezeichnet. Dabei handelt es sich um Töne, die so tief sind, dass sie Menschen normalerweise nicht wahrnehmen. Für Infraschall gibt es eine Vielzahl von natürlichen (Meeresbrandung, stark böiger Wind, Stürme, Unwetter…) und künstlichen Quellen (Verkehrsmittel, Windenergieanlagen, Kompressoren, Pumpen, leistungsfähige Lautsprechersysteme in geschlossenen Räumen…). Durch die gesetzlichen Abstände zwischen Windrädern und Wohnbebauung bleibt der von den Anlagen erzeugte Infraschall deutlich unter der Hör- und Wahrnehmungsschwelle des Menschen. Studien belegen, dass keine gesundheitlichen Belastungen zu befürchten sind.
Es hat sich herausgestellt, dass es in einer von Windkraftgegnern vielzitierten Studie der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) einen schwerwiegende Rechenfehler gibt, der die Ergebnisse grob verfälscht. Weiter Informationen finden Sie hier. Auf Grundlage dieser Studie setzte das Bundeswirtschaftsministerium die Infraschall-Belastung jahrelang als viel zu hoch ein. Jetzt entschuldigt sich der Bundeswirtschaftsminister bei der Windbranche.
Hier finden Sie weitere Informationen zum Thema Infraschall:
Faktencheck: Windenergie und Infraschall
Die Menge an Mikroplastik aus Rotorblättern ist im Vergleich zu anderen Quellen, insbesondere Autoreifen, vernachlässigbar.
Die Sorge, dass Windräder große Mengen Mikroplastik in die Umwelt eintragen könnten, ist unberechtigt. Der Deutsche Bundestag hat für das Jahr 2020 eine Worst-Case-Abschätzung für alle Windenergieanlagen (ca. 31.000) in Deutschland durchgeführt und ist auf einen maximalen Abrieb von 1.395 Tonnen pro Jahr gekommen. Der tatsächliche Wert dürfte jedoch deutlich niedriger liegen - bei wenigen 100 Gramm pro Anlage und Jahr. Eine Untersuchung in Norwegen ergab einen jährlichen Abrieb von ca. 200 g Mikroplastik pro Jahr und Windkraftanlage bzw. einen Abrieb von 2 kg über 10 Jahre.
Zum Vergleich: Der Abrieb von Schuhsohlen liegt bei etwa 8.720 Tonnen pro Jahr, der von Autoreifen sogar bei 98.280 Tonnen!
Viele Tourist*innen bevorzugen Reiseziele, die auf Nachhaltigkeit setzen. Windenergieanlagen können ein Symbol für Umweltbewusstsein und Zukunftsorientierung sein, was die Attraktivität von Regionen steigern kann.
Dass Tourismus und Windenergie nicht nur Hand in Hand gehen, sondern Windenergie sogar positive Effekte auf die Besucher- und Übernachtungszahlen haben kann, belegen verschiedene Studien und kreative Urlaubsorte. Laut einer Einflussanalyse des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa (NIT) würde nur einer von 100 Gästen einen Urlaubsort wegen eines Windparks in der Nähe meiden. Viel wichtiger für die Wahl des Reiseziels sind laut Umfrage andere Faktoren. So spielen beispielsweise die Qualität der Unterkünfte, die Preise und die Angebotsvielfalt vor Ort eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung der Urlauber. Eine Studie zu Windkraft und Tourismus in Österreich zeigt sehr deutlich, dass der Ausbau der Windenergie in Österreich keine negativen Auswirkungen auf die Nächtigungszahlen in den verschiedenen Regionen Österreichs hat.
Im Gegenteil, einige Tourismusorte konnten sogar einen Imagegewinn durch die Windenergie vor Ort verzeichnen. Windenergieanlagen stehen symbolisch für Innovationskraft, Zukunftsorientierung und Nachhaltigkeit. Informationsangebote zu Erneuerbaren Energien, Besichtigungen von Windenergieanlagen und integrierte Wander- oder Radwege bereichern inzwischen das touristische Angebot. Die Energielandschaft Morbach, das brandenburgische Feldheim, das Besuchergruppen aus aller Welt anzieht und das „WindErlebnis Ostfriesland“ sind einige Paradebeispiele, die zeigen, wie die Windenergie gerade im ländlichen Raum den Tourismus beleben und Übernachtungszahlen steigern kann.
Auch finanziell profitieren die Kommunen: Mit den Pachteinnahmen aus den Windenergieanlagen können neue touristische Angebote geschaffen werden, wie die Geierlay-Brücke in Rheinland-Pfalz. Die Gemeinde Mörsdorf baute 2015 mithilfe der Windpacht die damals längste Hängeseilbrücke Deutschlands für Fußgänger über einen Seitenarm der Mosel. Heute erhält der Ort allein aus den Windparks jährlich 300.000 Euro. Und weil sich die Brücke zu einem wahren Publikumsmagneten entwickelt hat, kommen inzwischen noch einmal 500.000 bis 600.000 Euro pro Jahr an Gebühren für die Besucherparkplätze hinzu. Alles in allem also mehr als eine Verzehnfachung des Budgets.
Deutsche Reisegruppen, aber auch Energiewende-Interessierte aus dem Ausland sorgen für Wertschöpfung vor Ort und haben positive Effekte für das örtliche Hotel- und Gaststättengewerbe sowie den Handel. Aufgrund des großen Interesses an erneuerbaren Energien gibt es inzwischen auch Reiseführer mit dem Schwerpunkt klimafreundliche Energieerzeugung.
Windenergie benötigt kein Endlager und hat kaum Auswirkungen auf das Grundwasser, die Luftqualität oder die menschliche Gesundheit - die gesellschaftlichen Kosten sind daher gering.
Die Stromerzeugung aus fossilen und nuklearen Energieträgern verursacht enorme gesellschaftliche Kosten, die nicht im Strompreis enthalten und damit für die Bürgerinnen und Bürger nicht unmittelbar nachvollziehbar sind. So sind diese Formen der konventionellen Stromerzeugung mit hohen Kosten für die Endlagerung, Umweltauswirkungen und Gesundheitsschäden verbunden. Man spricht hier von so genannten „externen Kosten“.
Ein Beispiel: Atommüll aus Kernkraftwerken muss für eine Million Jahre strahlensicher gelagert werden. Die Zwischen- und Endlagerung übernimmt der deutsche Staat in Form eines 2016 beschlossenen Staatsfonds in Höhe von 24 Milliarden Euro. 169 Milliarden Euro werden langfristig benötigt, um bis zur Jahrhundertwende ein entsprechendes Endlager betriebsbereit zu haben.
Weitere externe Kosten im Energiebereich entstehen zum einen durch den Ausstoß von Schadstoffen, die wiederum die Gesundheit von Mensch und Tier sowie die natürlichen Ökosysteme schädigen. Zum anderen greift der Abbau von Primärrohstoffen wie Kohle nachhaltig in die Natur ein. Für Kohlestrom beziffern Studien die Folgekosten weltweit auf rund 4.250.000.000.000 Euro.
Unter Berücksichtigung dieser gesamtgesellschaftlichen Kosten ist die Windenergie seit einigen Jahren die günstigste Stromquelle. Aber auch unabhängig davon sind Windenergie und andere Erneuerbare Energien preislich konkurrenzfähig. Das Windangebot ist unendlich und durch Forschung und Entwicklung werden Windenergieanlagen immer effizienter.
Häufig sind fehlende Netzkapazitäten, ein Überangebot von Strom, Wartungs- und Reparaturarbeiten oder Maßnahmen zum Schutz von Anwohner*innen, Vögeln und Fledermäusen der Grund dafür, dass Windenergieanlagen kurzfristig abgeschaltet werden.
Es gibt verschiedene Gründe dafür, dass Windenergieanlagen gelegentlich still stehen, obwohl Wind weht. Ein Grund dafür kann sein, dass bei starkem Wind zu viel Strom ins Netz eingespeist wird oder ein Überangebot an fossilem Strom die Netze blockiert, sodass die vorhandenen Netzkapazitäten den erzeugten Strom nicht schnell genug abtransportieren können. Dieses Problem kann durch ein optimiertes und leistungsfähiges Stromnetz, durch flexible Lastverschiebung, durch genauere Vorhersagen zur Einspeisung, und durch konsequentes Abschalten konventioneller Kraftwerke gelöst werden. Darüber hinaus können Speicherlösungen, wie Batteriespeicher oder auch die Nutzung von Elektrolyseuren für die Herstellung von Wasserstoff dabei helfen, den Strom vor Ort zu nutzen, um somit die Windenergieanlagen im Falle einer Netzüberlast erst gar nicht abschalten zu müssen.
Ein weiterer Grund für temporäre Abschaltungen sind Wartungs- und Reparaturarbeiten oder der Schutz von Vögeln und Fledermäusen während der Brut- und Zugzeiten. Zum Schutz von Anwohner*innen werden Anlagen ebenfalls abgeschaltet, wenn sie bei tief stehender Sonne länger als 30 Minuten am Tag Schatten auf angrenzende Wohngebäude werfen.
Eine weitere Möglichkeit Windenergieanlagen kurzfristig abzuregeln hat der Direktvermarkter, der den Strom an der Börse verkauft. Besteht ein Überangebot von Erzeugung bei gleichzeitig geringer Nachfrage, kann es kurzfristig zu geringen oder gar negativen Strompreisen kommen. Direktvermarkter haben die Möglichkeit, Windenergieanlagen in dem Falle abzuregeln, um die Preise zu stabilisieren. Durch die Kopplung von Sektoren (Wind, Biomasse, Solar), Abschaltung unflexibler konventioneller Kraftwerke, Speicherlösungen, grenzüberschreitenden Stromhandel sowie die Anpassung von Angebot und Nachfrage können negative Strompreise in Zukunft minimiert werden.
Der neue Windpark erfüllt lärmschutztechnisch alle Anforderungen, die durch das Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) und die TA-Lärm vorgeben werden. Dabei wird der Geräuschpegel bei maximaler Leistung zugrunde gelegt. Zusätzlich werden die Anlagen in der Nacht heruntergeregelt, um jederzeit eine erholsamen Schlaf gewährleisten zu können. Die Umgebungsgeräusche durch bspw. den Verkehr von der Bundesstraße oder Blätterrauschen sind meist lauter.
Sollte es zu einem Schattenwurf wegen tiefstehender Sonne (Frühjahr, Herbst) auf Wohnbebauung kommen, wird die Quelle dafür abgeschaltet. Laut Gesetz sind maximal 30 Minuten am Tag und nicht mehr als 30 Stunden im Jahr zulässig.
Der Anschluss an das Hochspannungsnetz erfolgt an einem zu errichtenden Umspannwerk entlang der 110 kV-Trasse der e.dis Netz in der Nähe von Saatel. Alle Kabel bis zu diesem Einspeisepunkt verlaufen unterirdisch.

Auswirkungen auf den Natur- und Artenschutz werden bereits bei der Planung einer Windenergieanlage berücksichtigt, werden so gering wie möglich gehalten und ggf. ausgeglichen.
Selbstverständlich ist auch eine Windenergieanlage ein Eingriff in die Natur. Wie bei jedem Bauvorhaben wird auch beim Bau von Windenergieanlagen im Rahmen des Planungs- und Genehmigungsverfahrens darauf geachtet, dass die Auswirkungen auf den Natur- und Artenschutz sowie auf das Landschaftsbild so gering wie möglich gehalten werden. Dabei wird genau geprüft, ob am geplanten Standort geschützte Vogel- und Fledermausarten vorkommen. Die Flugrouten dieser Tiere werden bereits in der Planungsphase berücksichtigt und artenschutzrechtlich bedeutsame Gebiete von vornherein ausgeschlossen. Sind Eingriffe in Natur und Umwelt unvermeidbar, müssen so genannte Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchgeführt werden, die den Eingriff angemessen kompensieren, z. B. durch Investitionen in Aufforstungen oder die Schaffung von Nahrungshabitaten für Vogelarten.
Alle 25 in Deutschland heimischen Fledermausarten sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt. Bei besonders hoher Fledermausaktivität werden die Anlagen vorsorglich abgeschaltet, um das Gefährdungspotenzial zu minimieren. Da die Rotorüberstände moderner Anlagen oberhalb der Flughöhe der meisten Tiere liegen, wird das Kollisionsrisiko langfristig ohnehin sinken. Im Fall des Rotmilans ist die Kollision mit den Rotorblättern außerdem ein sehr seltenes Zufallsereignis, wie die neuste Forschung zeigt.
Grundsätzlich gilt: 98 Prozent der Fläche Deutschlands stehen nicht für die Windenergienutzung zur Verfügung und bleibt somit frei von Windenergieanlagen. Bedacht werden sollte, dass Alternativen wie der Kohleabbau und ein ungebremster Klimawandel eine weitaus größere Bedrohung für die biologische Vielfalt in Deutschland darstellen als die Windenergie.
Im Genehmigungsverfahren gibt es gesetzliche Regelungen, die den Schutz von Menschen und Tieren sicherstellen. Es handelt sich hierbei um das Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmschG) und Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). So gibt es einen Katalog, der Abstände zu unterschiedlichen Vogelarten garantiert. Um genau bestimmen zu können, welcher Vogel wann und wo fliegt, werden externe Gutachten erstellt, die sich über mindestens eine Zug- bzw. Brutperiode erstrecken. Diese Gewissenhaftigkeit ist ein Grund für den langen Genehmigungsprozess von Windparks. Es geht auch darum, dem alten Mythos vom massenhaften Vogelschlag an WEA entgegenzutreten. So gibt es beispielsweise Systeme, die anfliegende Vögel am Flügelschlag erkennen und die Windenergieanlagen abschalten, sollte ein Kollisionsrisiko bestehen.
Auf Fledermäuse wird ebenfalls große Rücksicht genommen, Flugkorridore ermittelt und bei Kollisionsrisiko werden auch hier die entsprechenden Anlagen abgeschaltet. Darüber hinaus besteht das Angebot seitens der Energiequelle GmbH, dringend benötigte Nistkästen aufzuhängen, um den Mangel an natürlichen Quartieren in industriellen Forstplantagen auszugleichen.
Zum Schutz von Fledermäusen werden die Windenergieanlage im Zeitraum vom 01. April bis einschließlich 31. Oktober von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang abgeschaltet, wenn folgende Bedingungen gleichzeitig vorliegen:
- Niederschlagsfreie Nächte
- Windgeschwindigkeiten von < 6 m/s in Gondelhöhe (10-Minuten Mittelwert) und
- Temperaturen von mind. 10°C
Die Flughöhe von Fledermäusen variiert je nach Fledermausart. Um die allgemeine Kollisionsgefährdung von Fledermäusen an Windenergieanlagen (WEA) zu bewerten, gelten die Flughöhen der Fledermausarten als ein wesentliches Kriterium. Maßgeblich sind dabei Flughöhen, in denen die Tiere ausschließlich oder ganz überwiegend aktiv sind (z. B. bei der Jagd oder beim Zug). Besonders gefährdete Fledermausarten in Brandenburg sind Großer und Kleiner Abendsegler, Zweifarb-, Rauhaut-, Mücken- und Zwergfledermaus. Zweimal jährlich quert ein hoher Anteil der auch im nordöstlichen Europa reproduzierenden Fledermausarten während des Zuges in die Überwinterungs- bzw. Reproduktionsgebiete das Bundesland Brandenburg in breiter Front, sodass während dieser Zeit von einem erhöhten Kollisionsrisiko an WEA ausgegangen werden muss. Zudem können in Wäldern, entlang von Waldrändern und Baumreihen sowie in gewässerreichen Gebieten weitere Arten, wie v. a. Breitflügel- oder Nordfledermaus von einem erhöhten Kollisionsrisiko betroffen sein. Die Flughöhe der meisten Fledermäuse liegt zwischen 0 – 40 Metern (bodennah), bei einigen der oben genannten Arten bis zur Baumkrone und zwischen 300 bis 500 m (Großer Abendsegler).
Hierbei ist zu beachten, dass die Planung des Windparks nach Bundes Immissionsschutzgesetz (BlmschG) und Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) erfolgt. Damit werden im Zuge des Genehmigungsverfahrens Gutachten hinsichtlich Vögel, Fledermäusen, Reptilien, Amphibien und weitere Umweltverträglichkeitsprüfungen angefertigt, welche von unabhängigen Gutachtern erstellt werden müssen. Die Untersuchungsdauer für diese Gutachten beträgt in der Regel ein Jahr, da verschiedene Zyklen (z.B. Brutperioden, Wanderungsphasen u.a.) untersucht werden müssen.
SF6 kommt in der Energiebranche in vergleichsweise geringen Mengen zum Einsatz. Beim Rückbau von Anlagen wird das Gas recyclet, sodass es nicht in die Atomsphäre gelangt. Die Branche ist bemüht, zukünftig komplett auf das Gas zu verzichten.
Schwefelhexafluorid ist ein Gas, welches als Isolator fungiert und daher in Schaltanalgen eingesetzt wird. Es dient dem Schutz vor der Entstehung von Blitzen, bzw. Funken (Schaltlichtbögen) in den Anlagen. Bis heute gibt es keine gesetzlichen Regulierungen für SF6, sondern eine Selbstverpflichtung der Industrie, das Gas in geschlossenen Systemen einzusetzen und am Ende der Lebensdauer zu recyceln oder zu neutralisieren.
Das Umweltbundesamt ist der Auffassung, dass es ausreichend Alternativen für SF6 in neuen Mittel- und Hochspannungsschaltanlagen gibt oder in naher Zukunft geben wird. Die Behörden setzen sich daher, im Rahmen der Überprüfung des Anhangs III der Verordnung (EU) 517/2014, für ein Verbot von SF6 in neuen Schaltanlagen für alle Spannungsebenen ein.
Alternativen für SF6 sind zum Beispiel Vakuumröhren.
Moderne Windenergieanlagen sind leistungsstärker, sodass weniger Anlagen benötigt werden, um die gleiche oder eine höhere Strommenge zu erzeugen.
Um die deutschen Klimaziele zu erreichen, ist ein signifikanter Ausbau der Windenergie erforderlich. Aktuell sind in Deutschland rund 31.000 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von etwa 68.400 Megawatt installiert. Die Bundesregierung plant, die installierte Leistung der Windenergie an Land bis 2030 auf 115 Gigawatt zu steigern.
Dies erfordert einen jährlichen Brutto-Zubau von 10 Gigawatt. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die ausgewiesenen Flächen für Windenergie von derzeit 0,9 % auf 2 % der Bundesfläche erhöht werden. Die Bundesregierung hat verbindliche Flächenziele für den Windkraftausbau festgelegt. Bis 2032 müssen die Bundesländer mindestens 2 % ihrer Fläche für Windparks bereitstellen. Bundesländer mit besseren Windverhältnissen, wie Niedersachsen und Brandenburg, haben höhere Zielvorgaben von 2,2 %, während Länder mit schwächeren Windbedingungen, wie Bayern, nur 1,8 % ausweisen müssen. Stadtstaaten müssen 0,5 % nutzen. Diese Maßnahmen sollen die Energiewende beschleunigen und Klimaneutralität bis 2045 ermöglichen.
Die Frage, wie viele Anlagen auf Basis des 2-Prozent Flächenziels installiert werden müssen, kann nicht pauschal beantwortet werden, da dies von vielen Faktoren wie Flächengröße oder Flächenzuschnitt abhängt. Fakt ist jedoch: Moderne Windenergieanlagen sind leistungsstärker, sodass weniger Anlagen benötigt werden, um die gleiche oder eine höhere Strommenge zu erzeugen.
Durch Repowering kann die Stromerzeugung auf bestehenden Flächen außerdem effizient gesteigert werden. Dies verbessert auch den Artenschutz, da höhere Rotoren die Flugbahnen von Vögeln weniger beeinträchtigen.
Rein rechnerisch müsste der Anlagenbestand von heute 30.243 WEA auf ca. 35.000 steigen, um die Energiewende im Onshore-Bereich vollziehen zu können.
Erneuerbare Energien bringen Geld in die Kommunen, stärken den ländlichen Raum und ermöglichen Teilhabe für alle Bevölkerungsschichten.
Der Bau und Betrieb von Energieanlagen wie Windparks, Solarparks oder Biogasanlagen schafft bereits heute in vielen Regionen Deutschlands Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Über Gewerbesteuereinnahmen oder direkte finanzielle Beteiligungen spülen Erneuerbare Energien Geld in die kommunalen Kassen. In einigen Landkreisen sind Einnahmen für Kommunen und regionale Unternehmen in Milliardenhöhe möglich, wie eine Studie für den niedersächsischen Landkreis Rotenburg (Wümme) zeigt.
Das schafft Spielräume für Investitionen in Infrastruktur und öffentliche Daseinsvorsorge, die bei den Menschen vor Ort ankommen. Die Erneuerbaren Energien leisten so einen wirksamen Beitrag zum Abbau des Stadt-Land-Gefälles und stärken den ländlichen Raum, insbesondere in strukturschwachen Regionen.
Aber auch in den Städten können Bürgerinnen und Bürger von den Teilhabemöglichkeiten der Energiewende profitieren. Von der Haus- und Wohnungseigentümerin bis hin zum Mieter können alle Bevölkerungsschichten die vielseitigen Erneuerbaren Energietechnologien nutzen, um an der Energiewende teilzuhaben.
Dezentrale Erneuerbare Energien erhöhen die Sicherheit, indem sie Angriffe auf zentrale Infrastrukturen erschweren, lokale Unabhängigkeit fördern und kritische Einrichtungen in Krisen stabil versorgen.
In der Ukraine zeigen sich täglich die Nachteile zentraler Energieinfrastrukturen. Die dezentrale Energieerzeugung aus Erneuerbaren Energien reduziert das Risiko von Angriffen auf zentrale fossile Transportinfrastrukturen oder einzelne große Kraftwerke. Dezentral installierte Photovoltaikanlagen, Windparks und Biomassekraftwerke bieten eine breite Streuung von Energieerzeugungspunkten, was Angreifern die gezielte Lahmlegung der Energieversorgung erheblich erschwert.
Darüber hinaus ermöglicht die lokale Erzeugung von Strom und Wärme durch erneuerbare Energien eine stärkere Unabhängigkeit von nationalen und internationalen Versorgungsnetzen. Dies ist besonders in Krisensituationen von Vorteil, da Regionen und Kommunen autark operieren können.
Ein weiterer sicherheitspolitischer Vorteil ist die Möglichkeit, kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser, Wasserwerke oder Kommunikationszentren direkt mit dezentral erzeugtem Strom zu versorgen. Mit Batteriespeichern oder anderen Speichersystemen können solche Einrichtungen auch in Notfällen stabil und unabhängig bleiben.
Zudem tragen Erneuerbare Energien dazu bei, Umwelt- und Klimarisiken zu verringern, die langfristig ebenfalls sicherheitspolitische Dimensionen haben. Der Rückgang von fossilen Brennstoffen minimiert Konflikte um endliche Ressourcen, die oft geopolitische Spannungen auslösen.
Die Netzentgelte werden zukünftig auf alle Haushalte in Deutschland gleichermaßen aufgeteilt. Das bedeutet, dass die Kosten in Regionen, die viel erneuerbare Energien produzieren, spürbar sinken werden. Mecklenburg-Vorpommern wird deutlich von den Windparks profitieren.
www.bundesnetzagentur.de/verteilung-netzkosten